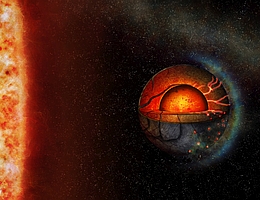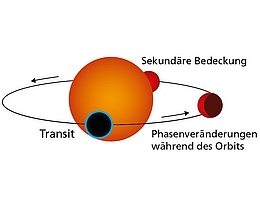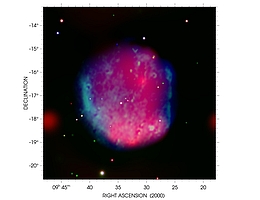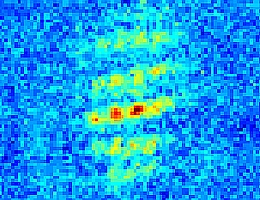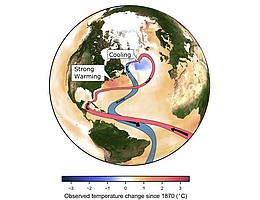SpaceX startet und landet Starship-Prototyp SN10
Aller guten Dinge sind drei: Nachdem bei zwei vorangegangenen Testflügen zwar der Start, nicht jedoch die Landung klappte, gelang dem US-amerikanischen Unternehmen SpaceX das Landemanöver nun bei einem suborbitalen Start des Starships mit der Seriennummer 10. Ein Wermutstropfen: Wenige Minuten nach der Landung explodierte das Testvehikel. Ein Beitrag von Patrick Schemel. Quelle: Elon Musk, SpaceX. […]
SpaceX startet und landet Starship-Prototyp SN10 Weiterlesen »