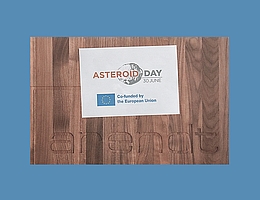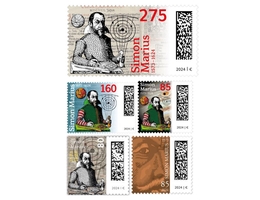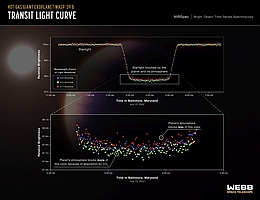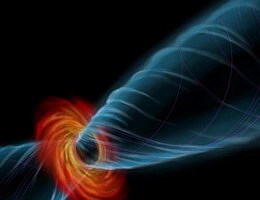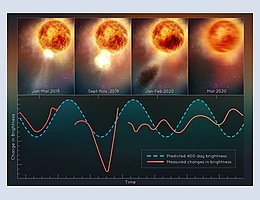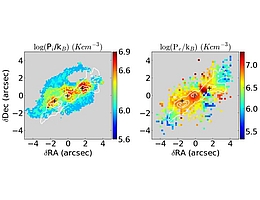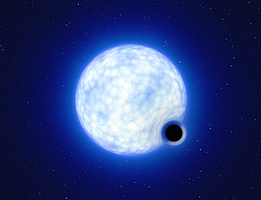Asteroid Day 2022: Warum das Ganze?
Was haben der 30. Juni 1908 und der 15. Februar 2013 gemeinsam? Über Entstehung und Organisation des Asteroid Day. Ein Beitrag von Kirsten Müller und Ingo Muntenaar. Sowohl am 30. Juni 1908 als auch am 15. Februar 2013 haben Ereignisse stattgefunden, die das Leben auf der Erde hätten weitgehend vernichten können, so wie es bereits […]