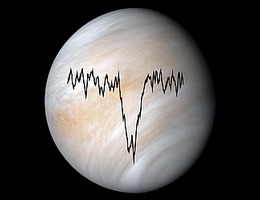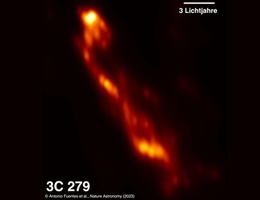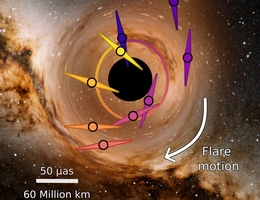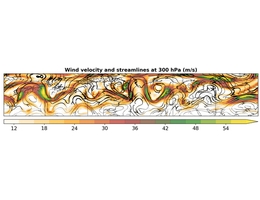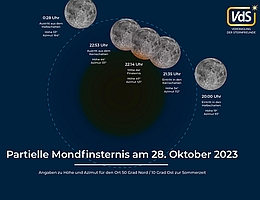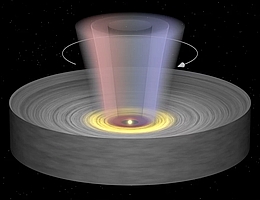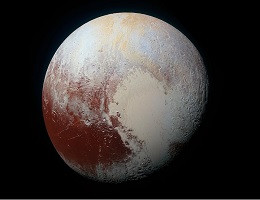AstroGeo Podcast: Kernenergie vor 2 Milliarden Jahren – der Atomreaktor Oklo
In einer Uran-Lagerstätte in Gabun fehlen große Mengen spaltbaren Materials. Das wirft in der Atom-Industrie viele Fragen auf und bringt einen unwahrscheinlichen Prozess ans Licht: In der Erdgeschichte bildeten sich natürliche Kernreaktoren.
AstroGeo Podcast: Kernenergie vor 2 Milliarden Jahren – der Atomreaktor Oklo Weiterlesen »